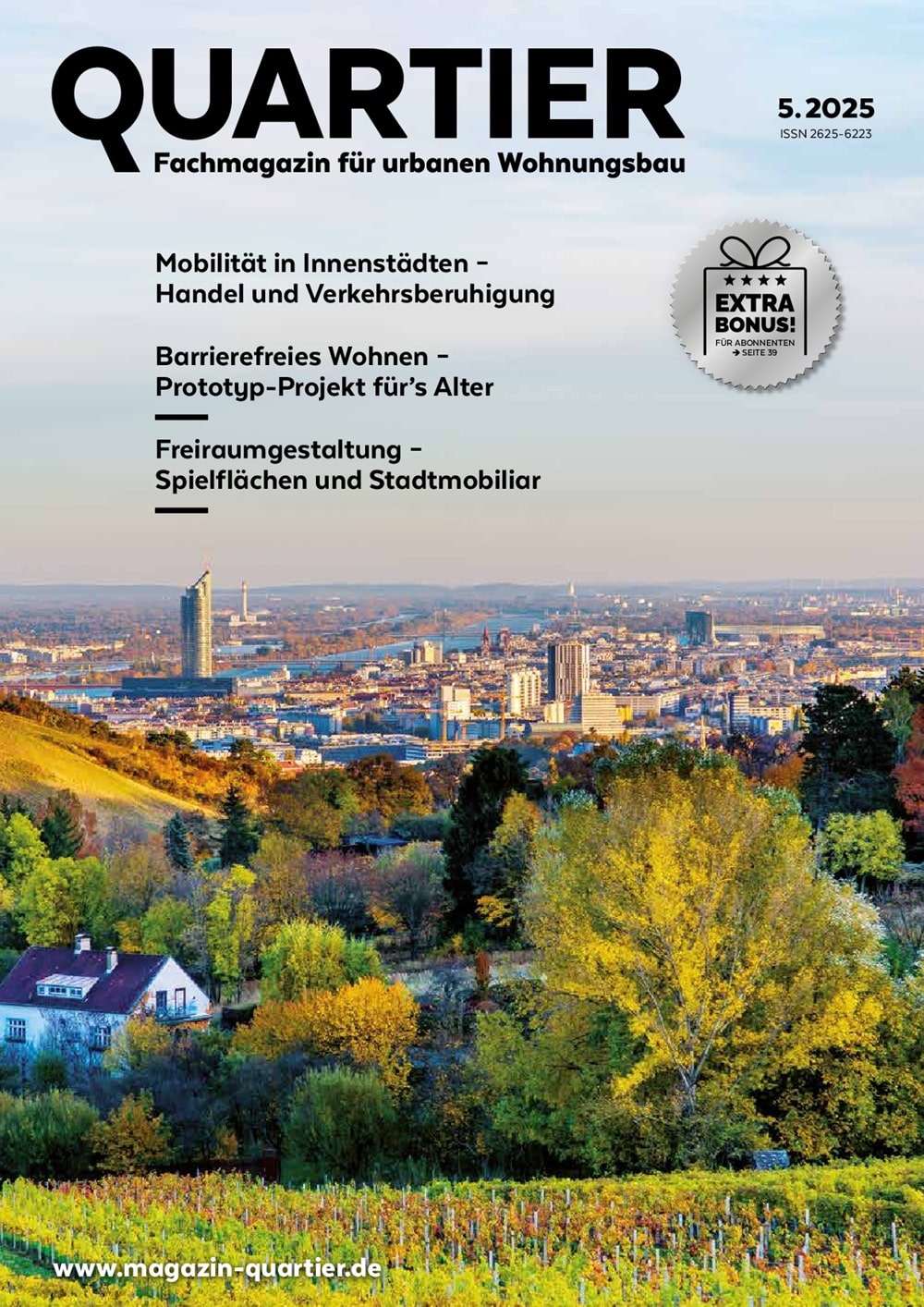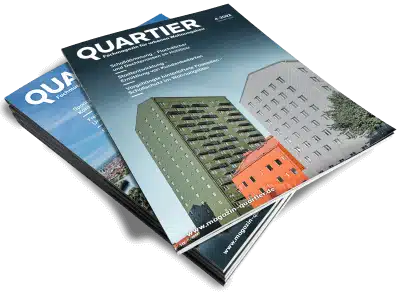Recht & Steuern
Erstes und zweites Modernisierungsgesetz 2024: Neues Stellplatzrecht in Bayern
Text: Bernd Müller | Foto (Header): © JC_STOCKER – stock.adobe.com
Am 10.12.2024 hat der Bayerische Landtag das Erste und Zweite Modernisierungsgesetz Bayern beschlossen. Beide Gesetze enthalten Änderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) – mit dem Ziel, Bauprozesse durch Vereinfachung und Entbürokratisierung effizienter zu gestalten. Danach entfällt seit dem 01.10.2025 die Verpflichtung zum Bau von Stellplätzen. Künftig wird dies nur noch durch lokale Satzungen geregelt. Doch bedeuten die Maßnahmen auch eine tatsächliche Vereinfachung?
Auszug aus:
QUARTIER
Ausgabe 5.2025
QUARTIER abonnieren
Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen
Verwaltungsvereinfachung, Bürokratieabbau, Kostensenkung – diese Schlagworte prägen die Agenda des öffentlichen Diskurses, wenn es um die vielgescholtene Wettbewerbssituation unseres Landes geht. Wer wird daher nicht zustimmend goutieren wollen, wenn der Gesetzgeber nunmehr nicht nur mahnen, sondern auch konkrete Taten folgen lassen möchte. In diesen Kontext sind das Erste und Zweite Modernisierungsgesetz 2024 des Freistaats Bayern (im Folgenden aus Gründen der Vereinfachung als ModG 2024 bezeichnet) einzuordnen, der sich in den im Dezember 2024 verabschiedeten Gesetzen, neben Änderungen in zahlreicher Verwaltungsvorschriften, auch das landesgesetzlichen Bauordnungsrecht zum Gegenstand einer gesetzlichen Deregulierung machte – mit der Absicht, Verfahren zu verschlanken, Standards zu deregulieren und somit die Kostenlast für Bauunternehmen und Immobilienkäufern im Zuge der Errichtung und Änderung von Gebäuden einzudämmen.
Bis zum 30.09.2025 galt im Freistaat Bayern landesweit, geregelt in Art. 47 BayBO (alt), die gesetzliche Pflicht, bei der (Neu-)Errichtung baulicher Anlagen sowie bei einer Änderung/Nutzungsänderung bestehender Anlagen, Stellplätze – bzw. den aus der geänderten Nutzung resultierenden Mehrbedarf an diesen – in ausreichender Zahl und Größe sowie Beschaffenheit herzustellen. Die seinerzeitige Aufnahme einer gesetzliche Stellplatzpflicht in der BayBO als Regelwerk des landesrechtlichen Bauordnungsrechts folgte aus der Erkenntnis, dass Bauvorhaben und deren Nutzung, sei es im gewerblichen Kontext oder aber im Zuge privater Wohnbauvorhaben, stets die Zunahme des meist motorisierten Individualverkehrs bedingen und die Unterbringung des ruhenden Verkehrs (Parken) dem Verursacherprinzip folgend bereits bauordnungsrechtlich reglementiert werden sollte. Die Regelung zur Unterbringung des „Deutschen liebsten Kindes“, des Automobils, auf oder jedenfalls in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Baugrundstücks hat der Gesetzgeber bis dato als seine gesetzliche Aufgabe verinnerlicht. Nicht zuletzt wegen des deutlichen Rückgangs verfügbarer Bauflächen und der in Zusammenhang mit der Herstellung privater Verkehrsflächen stehenden erheblichen Kostenlast, vollzieht nunmehr der Freistaat Bayern einen von ihm als „Systemwechsel“ bezeichneten Paradigmenwechsel bei der Stellplatzpflicht. Unter dem Stichwort der „Entbürokratisierung“ entfällt eine generelle, landesgesetzliche Pflicht zur Bereitstellung von Stellplätzen im Zuge von Bauvorhaben.
Ob und inwieweit Stellplätze verpflichtend gefordert werden, liegt nun ausschließlich in der Satzungshoheit der jeweiligen Gemeinden. Unter dem populären Schlagwort der „Kommunalisierung“ legt der bayerische Landesgesetzgeber die Entscheidung darüber, Stellplätze in Zusammenhang mit Bauvorhaben zu fordern, in die Hände der Gemeinden, wobei diesen in ihrer bisherigen Entscheidung beschränkt werden, Vorgaben über Beschaffenheit und Maß der vor Ort als notwendig erachteten Anzahl von Stellplätzen zu treffen. Dies wird ausschließlich durch die Bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) geregelt und insbesondere die als „notwendige Zahl der Stellplätze“ vom Freistaat Bayern in der zum 01.10.2025 in Kraft getretenen Anlage zu § 20 GaStellV (Anlage neu) definiert und somit in ihrer Höhe begrenzt.
Was wird durch das ModG 2024 in Bezug auf die Stellplatzpflicht in Bayern vereinfacht?
Höchstzahl als Obergrenze
Für Bauwerber, ob private Häuslebauer oder gewerbliche Bauunternehmen, ist zunächst klar, dass künftig bei Vorhaben im unbeplanten Innenbereich höchstens Stellplätze in der Anzahl lt. Anlage (neu) zu § 20 der GaStellV gefordert werden können. Dies ist bei der Projektion und Konzeption eines Bauvorhabens sicherlich hilfreich. Sollte das Vorhaben in einer Gemeinde geplant sein, die keine Satzung hat oder in ihren bisherigen Stellplatzregelungen eine höhere Anzahl als die für Bayern verbindlich vorgegebenen Höchstzahlen gefordert hat und diese Satzung nicht bis zum 30.09.2025 an die neue Rechtslage angepasst worden sein, besteht in dieser Gemeinde wegen des in letzterem Fall gesetzlich geregelten, automatischen Außerkrafttretens der Stellplatzsatzung als örtliche Bauvorschrift (zunächst) keine Stellplatzpflicht.
Aber wie so oft, gibt es Ausnahmen. Auch hier könnte dennoch eine Pflicht fortbestehen: Soweit die Stellplätze, insbes. deren Anzahl, individuell in Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen nach dem BauGB, die vor dem 30.09.2025 in Kraft gesetzt wurden, geregelt sind, gelten diese fort, selbst wenn sie eine höhere Anzahl ausweisen als in der Anlage (neu) gefordert, so Art. 83 Abs. 5, Satz 2, 2. HS, Art. 81 Abs. 2 Satz 1 BayBO. Die Ausnahme liegt in dem Umstand begründet, dass in Bebauungsplänen und/oder städtebaulichen Satzungen, die jeweilig vorgenommenen Festsetzungen i. d. R. auf einem auf das konkrete Plangebiet individuell abgestimmten Gesamtkonzept beruhen und im Rahmen des Planverfahrens umfassend abgewogen wurden. Im Gegensatz zu einer generalisierenden Regelung, also im Rahmen einer für das gesamte Gemeindegebiet geltenden Stellplatzsatzung, wird in einer Satzung nach dem bundesrechtlichen Baugesetzbuch somit die räumliche Geltung eingegrenzt. Daher sind Regelungen aus „alten“ Stellplatzsatzungen, welche in vor dem 01.10.2025 bestandskräftige Bebauungspläne eingeflossen sind, im Rahmen der sog. statischen Verweisung, nach wie vor zu beachten. Jedenfalls so lange, wie die städtebauliche Satzung/der Bebauungsplan nicht geändert wird.
Keine zusätzlichen Stellplätze bei Umwandlung zu Wohnraum im Bestand
Vereinfacht wird jedenfalls die Frage nach Stellplätzen (nämlich keine, Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b) 2. HS. BayBO) bei der Umwandlung zu Wohnraum im Bestand, beim Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnzwecken oder aber bei der Aufstockung bestehender Gebäude mit Wohnungen (bisherig geltende Stellplatzsatzungen als örtliche Bauvorschriften können diesen Vorhaben schon vor dem 30.09.2025 wg. der bereits seit dem 01.01.2025 geltenden gesetzlichen Vorschrift lt. Art. 81 Abs. 5 BayBO i. V. m. Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO nicht entgegenstehen). Für Nutzungsänderung baulicher Anlagen zu Wohnzwecken dürfen ab dem 01.10.2025 keine widersprechenden Satzungsregelungen (neu) getroffen werden.
Vorgabe zu Größe und Ausgestaltung
Ferner können in neuen, ab dem 01.10.2025 geltenden Satzungen keine Vorgaben mehr zu Größe und Ausgestaltung der Stellplätze getroffen werden. Der neu gefasste Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO ermöglicht damit künftig lediglich die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen. Bei Fragen zur Größe ist die nach wie vor geltende GaStellV heranzuziehen. Doch auch hier können, wie im Folgenden dargelegt, noch Ausnahmen gelten.
Stellplatznachweis
Art und Weise des Stellplatznachweises bleibt ausschließlich dem Satzungsrecht vorbehalten. Gleiches gilt für Ablöseregelungen mit der Besonderheit, dass die Höhe der Ablösesumme nicht mehr frei bestimmt werden kann, sondern auch in der Höhe durch die (tatsächlichen) Kosten der Herstellung gedeckelt wären. Regelt die neue Satzung nichts, dann müssen die Stellplätze auf dem Baugrundstück hergestellt werden.
Ist der Wegfall der gesetzlichen Stellplatzpflicht im ModG 2024 tatsächlich eine Maßnahme der Entbürokratisierung?
Hier kommt es auf den Blickwinkel an. Der Landesgesetzgeber wird für sich in Anspruch nehmen wollen, durch eine „Verschlankung“ der gesetzlichen Forderungen im Bauordnungsrecht in Bezug auf die Stellplätze einen wesentlichen Beitrag zur Entbürokratisierung geleistet zu haben. Entscheidend jedoch ist nach diesseitigem Verständnis, ob beim Anwender des Gesetzes, den Kommunen, den Bauämtern in den Städten und Landratsämtern sowie dem Bauwerber als solchen ein geringerer Aufwand als bisher zu erwarten ist. Das darf indes bezweifelt werden. Dies beginnt schon mit der Frage, wie viele Stellplätze im Einzelfall konkret gefordert werden und somit geplant werden müssen.
- Tatsächlich ist in Bezug auf die Nutzungsänderung bzw. den nachträglichen Einbau von Wohnungen in Bestandsgebäuden eine Vereinfachung und auch eine Entbürokratisierung zu erwarten. Selbst bei Fortgeltung bisherigen Satzungsrechts können in diesen Fällen die örtlichen Bauvorschriften nicht entgegengehalten werden, siehe oben.
- Dem Bauwilligen bleibt daher jedenfalls der Gang zum Rathaus nicht erspart. Zum einen, um die Frage zu beantworten, ob ab dem 01.10.2025 vor Ort eine kommunale Bauvorschrift, welche die Herstellung von Stellplätzen anordnet, existiert. Zum anderen, um ggf. die in der geltenden Satzung geforderte Anzahl in Erfahrung zu bringen. Denn in örtlichen Bauvorschriften ist eine Reduzierung von der Stellplatzzahl der GaStellV nach wie vor zulässig. Aus der anwaltlichen Beratungspraxis und der Kenntnis der kommunalen Lebensrealität ist jedoch zu vermuten, dass zahlreiche Gemeinden, sofern sie bereits über eine Stellplatzsatzung verfügten, diese mittlerweile der neu geltenden Rechtslage angepasst haben. Dies kann im Übrigen im Einzelfall u. U. zur Folge haben, dass insbesondere bei Neubauvorhaben im Wohnungsbau nunmehr pauschal für jede Wohnung zwei Stellplätze gefordert werden, auch wenn in der Vergangenheit zwischen kleineren und größeren Wohnungen differenziert wurde. Auf die automatische Außerkraftsetzung bestehender Stellplatzsatzungen und somit dem Wegfall einer Stellplatzpflicht in Bayern sollte daher der Bauwerber nicht vertrauen. Nicht zuletzt aufgrund einer umfangreichen Informationspolitik durch die kommunalen Spitzenverbände in Bayern im Vorfeld des Inkrafttretens der Neuregelungen ist damit zu rechnen, dass zahlreiche Bestands-Stellplatzsatzungen, welche neben der Anzahl der Stellplätze auch Vorgaben über Ausgestaltung und Beschaffenheit derselben getroffen haben, gerade nicht von der automatischen Außerkraftsetzung der örtlichen Bauvorschriften betroffen sind und weitestgehend fortgelten. Auch die oben skizzierte Regelung zu Stellplätzen in bestehenden Bebauungsplänen oder anderen Satzungen nach dem Baugesetzbuch mit Hinweis auf bisherige, nunmehr nicht mehr mögliche Stellplatzsatzungen, vereinfachen des Weitern das Verfahren bzw. den bürokratischen Aufwand nicht unbedingt. Ein Weniger an Bürokratie ist damit aus Sicht des Normadressaten jedenfalls nicht zu erkennen.
- Schließlich haben mit Sicherheit auch Gemeinden, welche im bisherigen Vertrauen auf die gesetzliche Regelung zur verpflichtenden Herstellung von Stellplätzen bislang keinen Regelungsbedarf durch örtliche Bauvorschriften sahen, durch den vollzogenen Systemwechsel nunmehr erstmalig Stellplatzsatzungen als örtliche Bauvorschriften erlassen, ggf. auch auf Basis der bisherigen, bis zum 30.09.2025 geltenden Rechtslage zur Ausstattung, Zuwegung, Begrünung etc.
Wie stehen die Gemeinden zu der „Kommunalisierung“ der Stellplatzpflicht?
Auch hier gibt es naturgemäß unterschiedliche Auffassungen. Auf der einen Seite ist es aus gemeindlicher Sicht stets zu begrüßen, wenn den Gemeinden durch den Gesetzgeber mehr Handlungsspielraum eingeräumt wird. Auf der anderen Seite müssen Gemeinden – auch in Bayern – zuweilen erleben, dass unter dem grundsätzlich positiv konnotierten Begriff der „Kommunalisierung“ allzu oft die Verantwortung zur Regelung maßgeblicher Lebenssachverhalte einseitig auf die kommunale Ebene übertragen wird, obgleich eine landesweit geltende, gesetzliche Regelung, nicht zuletzt aus Gründen der landeseinheitlichen Rechtssicherheit, in hohem Interesse der Betroffenen wäre. Vor dem Hintergrund des Wegfalls der gesetzlichen Verpflichtung sahen sich Kommunen gezwungen, den Weg zum Erlass einer örtlichen Bauvorschrift einzuschlagen. Das Spannungsfeld zwischen dem immer knapper werdenden Angebot an Parkplätzen bzw. dem vielerorts schlicht fehlenden Platz im öffentlichen Raum und dem auch seitens der Gemeinden anerkannten, ressourcenschonenden Umgangs mit Grund und Boden, lässt vielerorts den Verantwortlichen in den Rathäusern keine andere Wahl. Letztlich sehen die Kommunen in dem Wegfall einer generellen gesetzlichen Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen die Verlagerung der Problembewältigung des aus Bauvorhaben resultierenden anwachsenden (ruhenden) Verkehrs vom ursächlichen Baurecht ins Straßenverkehrsrecht, dessen Vollzug bislang schon den Gemeinden obliegt und – im besten Falle nur – zu erheblichen Diskussionen, häufig auch zu Konfliktlagen mit der örtlichen Bevölkerung führt. Nachdem die Zurverfügungstellung von Parkmöglichkeiten im Zuge von Bauvorhaben nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein die Attraktivität des Immobilienbestands prägender Umstand ist, wird die Neuregelung Stellplatzpflicht im ModG 2024 vielerorts den nach wie vor dringend notwendigen Dialog zwischen Gemeinden und Bauwirtschaft bei der Realisierung von Bauvorhaben nicht ersetzen und auf beiden Seiten einen Zuwachs an rechtlichem Beratungsbedarf auslösen.
Der Autor
Bernd Müller
Bernd Müller, Rechtsanwalt und Bürgermeister a.D., ist seit Dezember 2021 bei der Augsburger Rechtsanwaltskanzlei Meidert & Kollegen hauptsächlich mit kommunalen Fragestellungen betraut.
www.meidert-kollegen.de