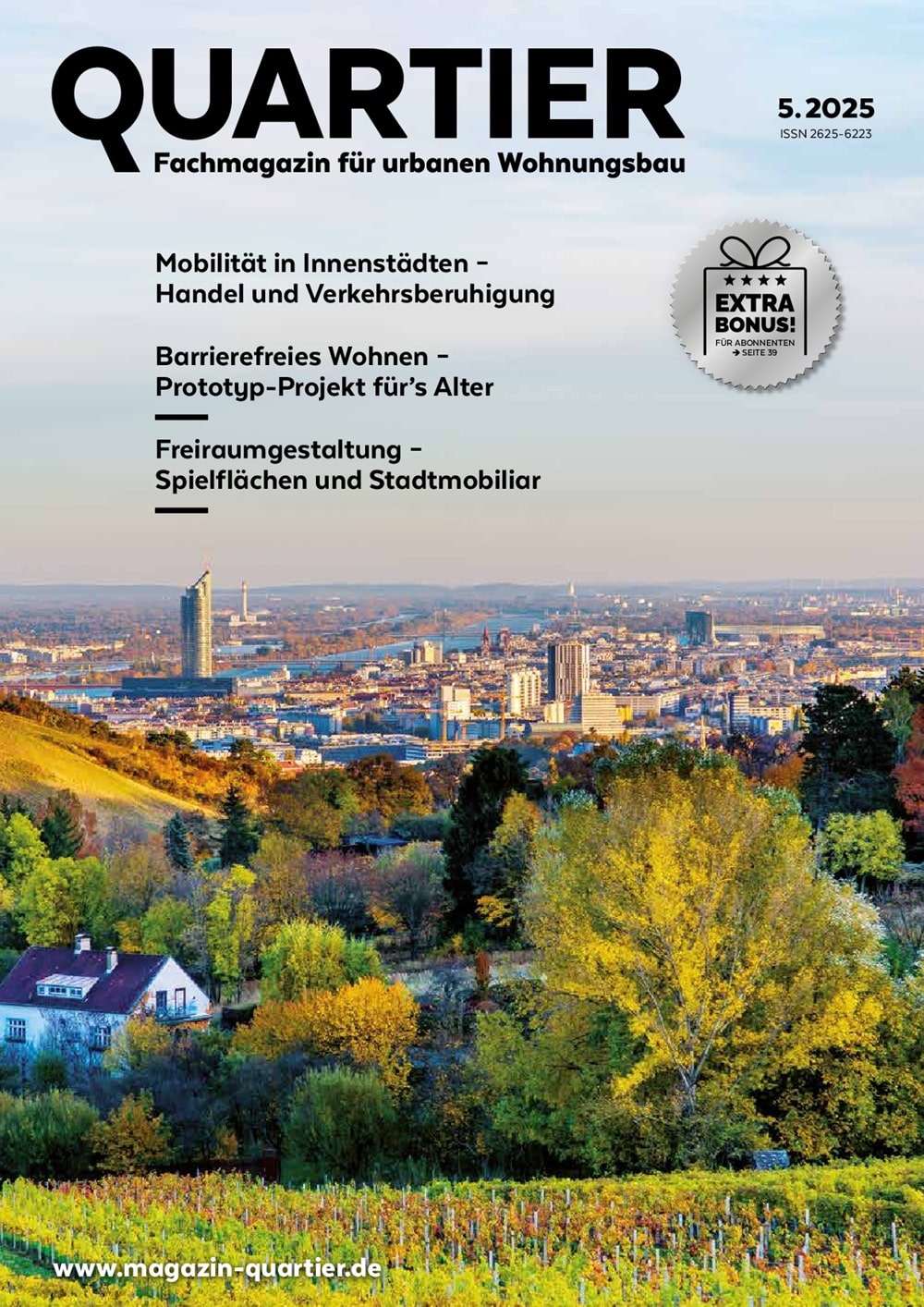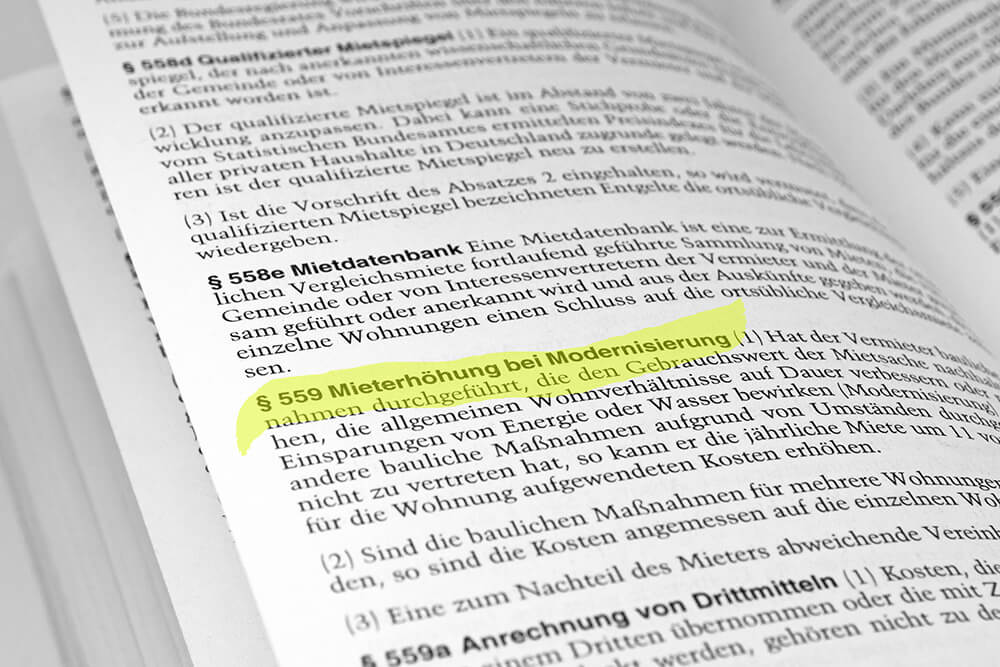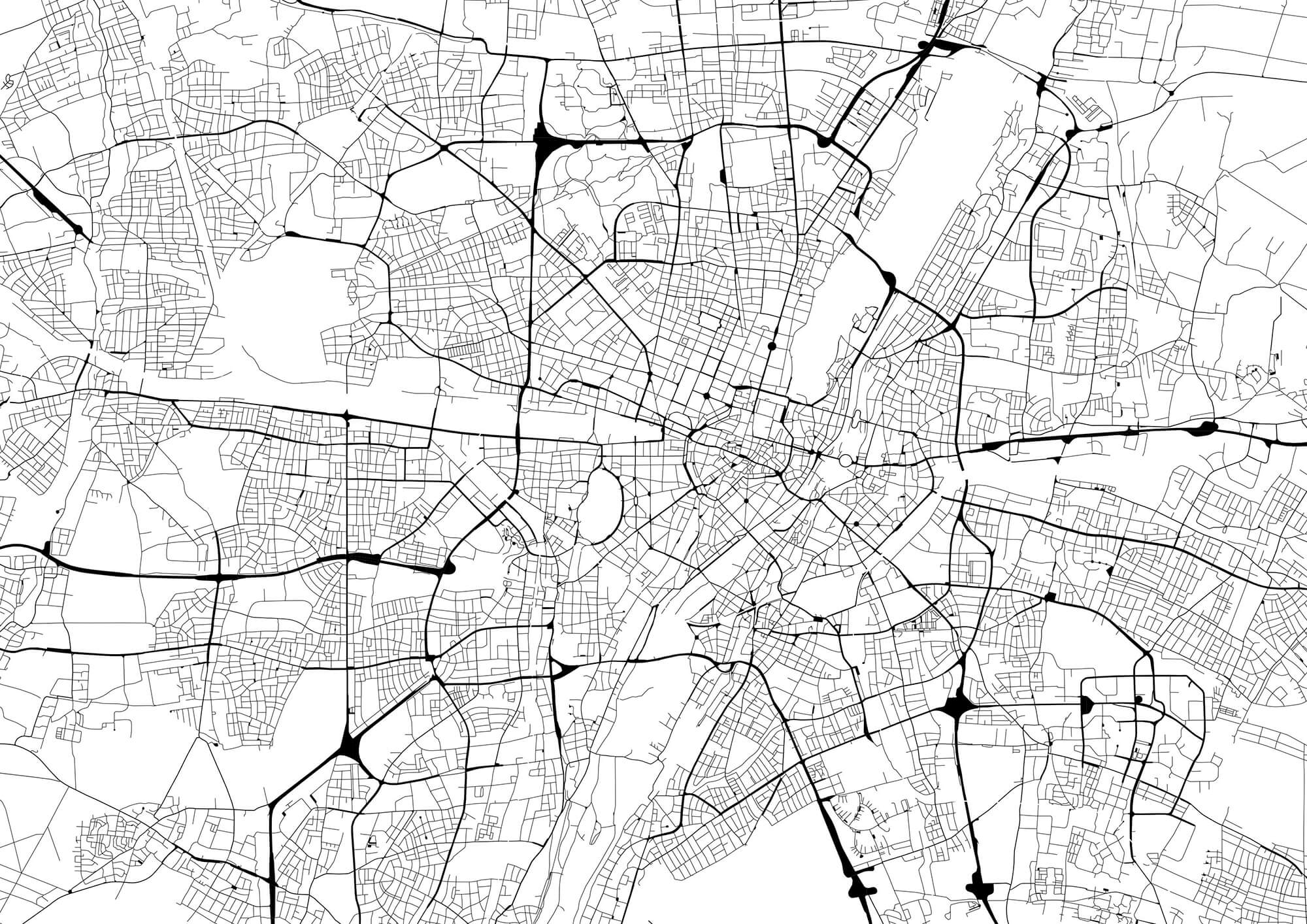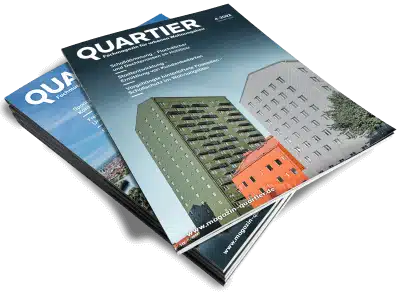Kosten & Finanzierung
Neues Urteil zur Modernisierungsmieterhöhung: Mehr Spielraum für Vermieter
Text: Prof. Dr. Ulf P. Börstinghaus | Foto (Header): © Nmann77 – stock.adobe.com
Im Urteil vom 26.03.2025 hat der BGH sich mit der Frage beschäftigt, wann eine zur Modernisierungsmieterhöhung berechtigende energetische Modernisierung i. S. d. § 555b Ziff. 1 BGB vorliegt. Für Vermieter ergeben sich daraus größere Spielräume.
Auszug aus:
QUARTIER
Ausgabe 5.2025
QUARTIER abonnieren
Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen
Mieterhöhungen im preisfreien Wohnungsbau beruhen grundsätzlich auf dem Prinzip der Vertragsfreiheit. Die Mietvertragsparteien sollen sich über die Höhe der Miete einigen. Dies gilt uneingeschränkt für die Neuvertragsmiete, entspricht aber ebenso den Vorstellungen des Gesetzgebers für Mieterhöhungen im Bestand.
Auch wenn der Vermieter gem. § 558 BGB unter bestimmten Umständen einen Anspruch auf die Zustimmung des Mieters zur Vertragsänderung hat, so stellt der Gesetzgeber die Einigung in den Vordergrund. Für einen wichtigen Bereich erlaubt das Gesetz dem Vermieter aber, einseitig die Miete zu erhöhen, ohne dass es der Zustimmung des Mieters dazu bedarf: Das sind die sieben unterschiedlichen baulichen Veränderungen in § 555b BGB, auf die in § 559 Abs. 1 BGB ausdrücklich verwiesen wird. Hier kann der Vermieter die Miete um 8 % der notwendigen Kosten der Baumaßnahme ohne die anteiligen Erhaltungskosten jährlich erhöhen. Deshalb handelt es sich bei § 559 BGB anerkanntermaßen um eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift. Die Konsequenz dieser Unterscheidung ist, dass eine formell oder materiell unwirksame Mieterhöhung nach § 558 BGB wirksam ist, wenn der Mieter zugestimmt hat oder zur Zustimmung verurteilt wurde.
Das ist bei der einseitigen Mieterhöhung nach einer Modernisierungsmaßnahme gerade anders. Hier führen Fehler zur (Teil-)Unwirksamkeit der Erhöhung mit der Folge, dass die Zahlungen des Mieters rechtsgrundlos erfolgen und zurückverlangt werden können.
BGH präzisiert Modernisierungsmieterhöhung
Im vorliegenden Fall – und drei weiteren Entscheidungen des Senats vom gleichen Tag – hatte der Vermieter den Mietern die im Einzelnen genau beschriebene Modernisierung der in dem Haus befindlichen Heizungsanlage durch den erstmaligen Einbau einer Gaszentralheizung einschließlich zentraler Warmwasseraufbereitung anstelle der bis dahin in den Wohnungen vorhandenen Einzelöfen (Kombithermen) angekündigt. Nach Beendigung der Arbeiten erklärte der Vermieter den Mietern gegenüber eine Erhöhung der monatlichen Grundmiete von 487,33 Euro um 59 Euro auf 546,33 Euro. Die Mieter zahlten die erhöhte Miete bis zum Ende des Mietverhältnisses. Nach ihrem Auszug verlangten sie die Rückzahlung der gezahlten Erhöhungsbeträge. Die Klage hatte vor dem Landesgericht (LG) Bremen (Az. 2 S 232/20) zunächst Erfolg. Das LG hielt die Mieterhöhung für unberechtigt, weil der Vermieter keine nachhaltige Energieeinsparung nachgewiesen habe. Die Einsparung von Endenergie könne allein anhand eines Vergleichs des tatsächlichen Verbrauchs vor und nach der Maßnahme festgestellt werden, wobei die Kammer wegen der jährlichen Schwankungen im Energieverbrauch einen Vergleichszeitraum von jeweils vier bis fünf Jahren vor und nach der Maßnahme berücksichtigt wissen wollte. Da das Haus zuvor mit Einzelöfen beheizt wurde, konnte der Vermieter keinerlei Vergleichswerte für die Zeit vor der baulichen Veränderung benennen.
1 | Der Vermieter kann eine Mieterhöhung gem. § 559 Abs. 1 BGB bereits dann verlangen, wenn nach dem Abschluss der Modernisierungsarbeiten zum Zeitpunkt der Abgabe der Mieterhöhungserklärung (ex ante) eine allein durch die erfolgte bauliche Veränderung hervorgerufene messbare und dauerhafte Einsparung von Endenergie zu erwarten ist.
M. Schuppich – stock.adobe.com
Entscheidung und Vorgehensweise des BGH
Der BGH hat einer solchen äußerst restriktiven Auslegung des Begriffs der energetischen Modernisierung ausdrücklich widersprochen. Bereits dem Ansatz des LG, ausschließlich auf den tatsächlichen Energieverbrauch in dem Gebäude abzustellen, folgt er nicht.
Dazu befasst sich der Senat zunächst mit den verschiedenen „Energiebegriffen“: Unter Endenergie ist die Menge an Energie zu verstehen, die der Anlagentechnik eines Gebäudes (Heizungsanlage, raumlufttechnische Anlage, Warmwasserbereitungsanlage) zur Verfügung stehen muss, um die für den Mieter erforderliche Nutzenergie sowie die Verluste der Anlagentechnik bei der Übergabe, der Verteilung, der Speicherung und der Erzeugung im Gebäude zu decken. Sie wird an der „Schnittstelle“ Gebäudehülle gemessen und dort etwa in Form von Heizöl, Erdgas, Braunkohlebriketts, Holzpellets, Strom oder Fernwärme übergeben. Der Begriff der Endenergie ist somit weiter als derjenige der Nutzenergie. Unter Nutzenergie wird diejenige Menge an Energie verstanden, die für eine bestimmte Energiedienstleistung am Ort des Verbrauchs erforderlich ist.
Endenergie wird zum einen typischerweise dann eingespart, wenn zur Erbringung derselben Energiedienstleistung am Ort des Verbrauchs weniger Nutzenergie als vor der Modernisierung erforderlich ist. Zum anderen liegt eine Endenergieeinsparung vor, wenn die Nutzenergie mit größerer Effizienz (bspw. durch Erneuerung des Heizkessels oder die Verringerung der Wärmeverluste zwischen Heizkessel und Heizkörpern) zur Verfügung gestellt wird. Diese Einsparung muss „durch“ die bauliche Veränderung herbeigeführt worden sein. Damit ist die Anknüpfung des LG an den tatsächlichen Energieverbrauch nicht vereinbar. Dieser wird von einer Vielzahl von Parametern (z. B. Wetter, Heizverhalten etc.) bestimmt, die sich im Regelfall weder im Vorfeld sicher abschätzen noch im Nachhinein vollständig aufklären und feststellen lassen.
Der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und deshalb dem Vermieter gestattet, im Rahmen der Mieterhöhungserklärung auf anerkannte Pauschalwerte Bezug zu nehmen. Diese gesetzgeberische Grundentscheidung liefe aber ins Leere, wenn für die Bestimmung der Energieeinsparung letztlich doch der tatsächliche Verbrauch herangezogen werden müsste. Der Vermieter könnte nur schwer absehen, ob er deren Kosten im Wege einer Mieterhöhung zumindest teilweise auf die Mieter umlegen kann. Nach Ansicht des LG müsste er ca. fünf Jahre nach der baulichen Maßnahme abwarten, bis er eine Erhöhung verlangen könnte. Eine solche „Sperrfrist“ sieht das Gesetz nicht vor.
Das führt zu dem Ergebnis, dass der Vermieter eine Mieterhöhung gem. § 559 Abs. 1 BGB bereits dann verlangen kann, wenn nach dem Abschluss der Modernisierungsarbeiten zum Zeitpunkt der Abgabe der Mieterhöhungserklärung (ex ante) eine allein durch die erfolgte bauliche Veränderung hervorgerufene messbare und dauerhafte Einsparung von Endenergie zu erwarten ist. Hierbei kann auf anerkannte Pauschalwerte, wie etwa diejenigen in der Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand vom 08.10.2020 (BAnz AT 04.12.2020 B1) zurückgegriffen werden.
Handlungsbedarf
Das Urteil erleichtert die Darlegung einer energetischen Modernisierung. Da in den kommenden Jahren aufgrund der immer strengeren Vorgaben des Gesetzgebers für den Betrieb von Heizungsanlagen und der massiv steigenden Energiepreise durch die CO₂-Abgabe solche Modernisierungen verstärkt vorgenommen werden müssen, sind die praxisgerechten Vorgaben des Senats an die Darlegung hier äußerst hilfreich. Diese im vorliegenden Verfahren für die Darlegung der Energieeinsparung im Rückforderungsprozess des Mieters gemachten Ausführungen gelten ohne Einschränkungen auch für die Modernisierungsmieterhöhungserklärung gem. § 559b BGB. Auch hier kann auf Pauschalwerte Bezug genommen werden.
Das Urteil zeigt über die vermieterfreundliche Auslegung des Begriffs der energetischen Modernisierung noch ein besonderes Problem der Modernisierungsmieterhöhung auf: Fehler werden hier nicht verziehen! Selbst wenn der Mieter jahrelang die verlangte Mieterhöhung gezahlt hat, hindert ihn das nicht, später die Unwirksamkeit geltend zu machen und die gezahlten Beträge zurückzuverlangen. Die Grenze stellt allenfalls die Verjährung dar. Besondere Bedeutung hat dies z. B. auch bei der Ermittlung der abzuziehenden Erhaltungskosten. Wenn diese gar nicht oder in einem zu geringen Umfang abgezogen wurden, kann der Mieter Zahlungen aufgrund unberechtigter einseitiger Erhöhungen zurückverlangen. Sicherer ist der Weg, sich mit dem Mieter auf eine Erhöhung zu einigen. In diesem Fall liegt eine Zustimmung des Mieters zur Vertragsänderung vor, was eine Rückforderung regelmäßig ausschließt. Ebenfalls hilfreich kann es sein, zeitnah nach der Modernisierungsmieterhöhung eine Mieterhöhung auf die neue ortsübliche Vergleichsmiete für modernisierten Wohnraum zu verlangen. Die Zustimmung des Mieters bezieht sich nicht nur auf den Erhöhungsbetrag, sondern auf die neue Gesamtmiete. Auch in diesem Fall werden alle Fehler der Vergangenheit geheilt.
Der Autor
Prof. Dr. Ulf P. Börstinghaus
Bis Mitte 2022 Richter am Amtsgericht. (Mit-)Autor von zahlreichen juristischen Fachbüchern, insbesondere des Standardkommentars zum Mietrecht „Schmidt-Futterer“. Mitherausgeber der mietrechtlichen Fachzeitschrift „Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht“ (NZM). Mitbegründer und Ehrenvorsitzender des Deutschen Mietgerichtstages e. V., Dozent an der Deutschen Richterakademie und bei Seminaren für die Anwaltschaft und die Wohnungswirtschaft. Er ist Honorarprofessor an der Universität Bielefeld. Im Jahr 2019 hat der Bundespräsident ihm für seine Verdienste für das Mietrecht das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.