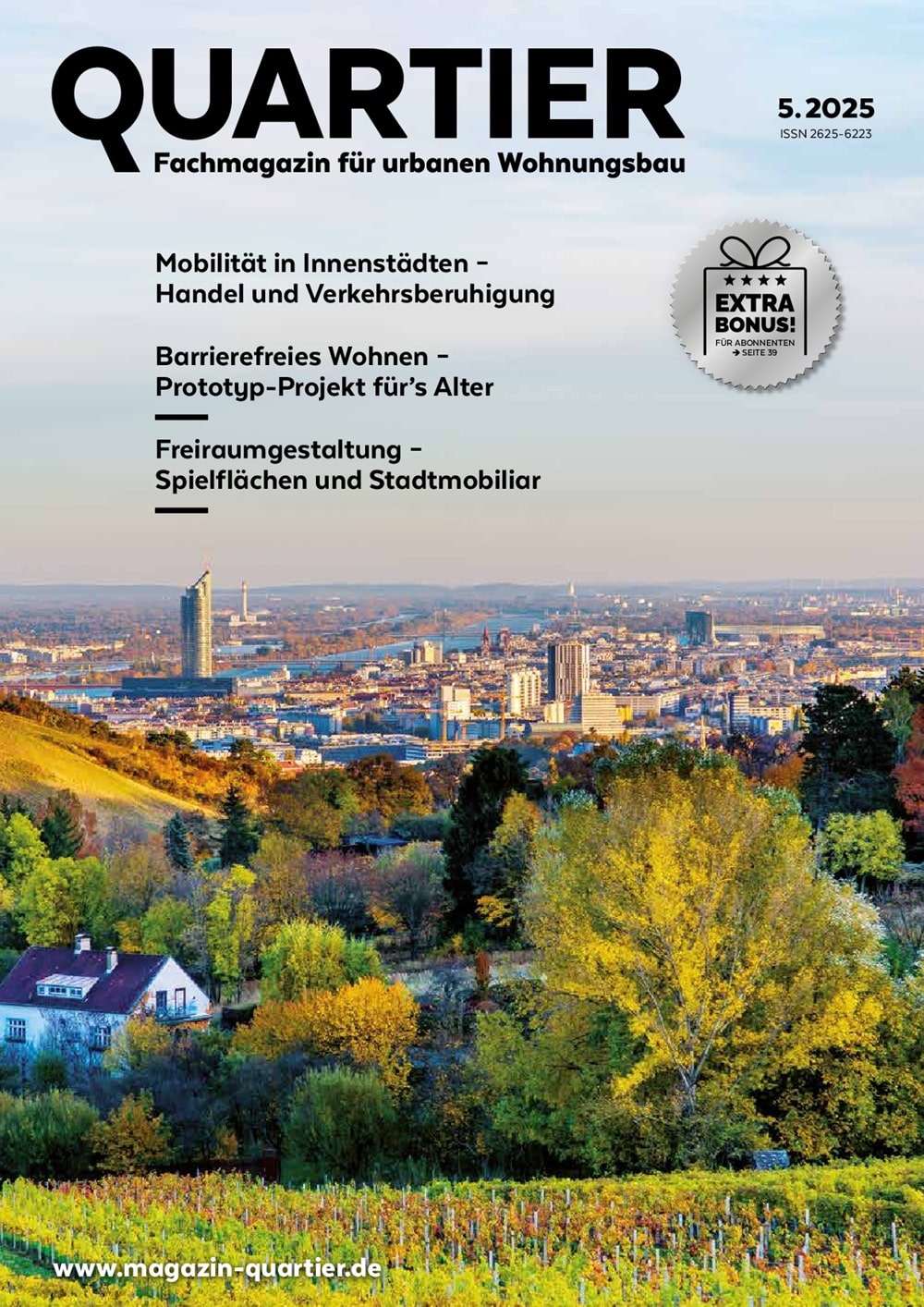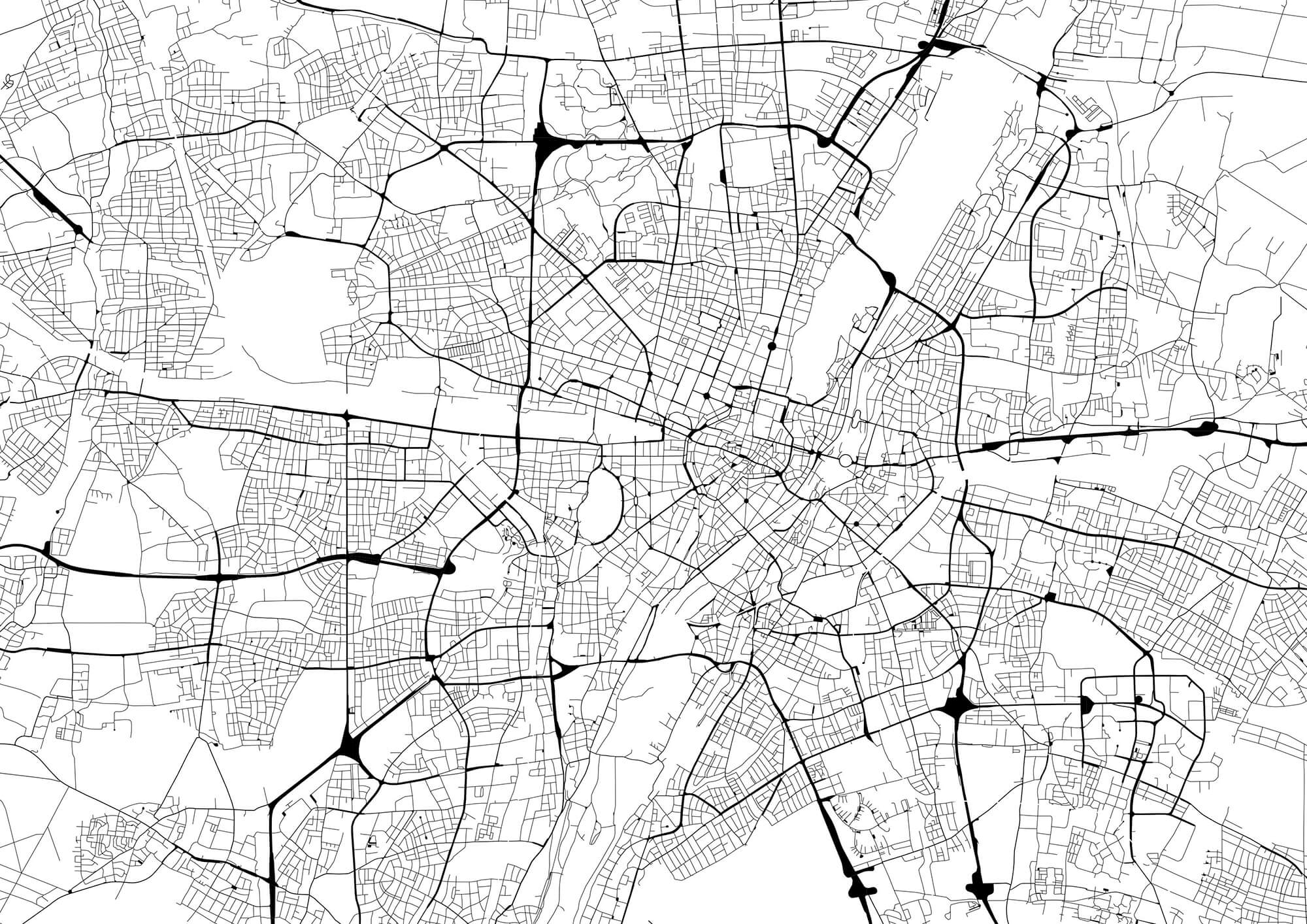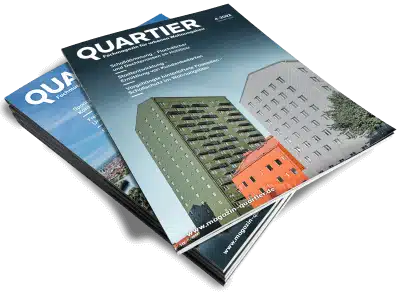Im Gespräch mit Peter Schraml
Planung von inklusiven Spielflächen: Spielplätze für alle
Foto (Header): © MASSSTAB MENSCH

Foto: MASSSTAB MENSCH
Der Spielplatz ist ein idealer Ort für Kinder, um sich im gemeinsamen Spielen unvoreingenommen, mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Dabei sollen diese Orte für alle gleichermaßen nutzbar sein. Wir sprechen mit Peter Schraml, Geschäftsführer der Firma „Massstab Mensch – barrierefrei & sicher leben“, über die beste Herangehensweise bei der Planung von inklusiven Spielplätzen.
Auszug aus:
QUARTIER
Ausgabe 5.2025
QUARTIER abonnieren
Jetzt diese Ausgabe als Einzelheft bestellen
Herr Schraml, was macht eine Spielfläche zu einem inklusiven Spielplatz?
Ein Spielplatz wird grundsätzlich zu einem inklusiven Spielplatz, wenn für alle ein Angebot vorhanden ist, wobei nicht alles von allen nutzbar sein muss. Damit dies möglich wird, müssen die Grundbedingungen der Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Benutzbarkeit erfüllt sein. Das beste Angebot ist nicht nutzbar, wenn der Zugang nicht möglich ist – entspricht dieser allerdings dem Zwei-Wege- Prinzip, kann jeder Nutzer den Spielplatz auch betreten. Die Erreichbarkeit betrifft z. B. den Weg vom Eingang bis zum Spielangebot selbst. Steht eine Schaukel im Sand, ist vom Nutzer zwar evtl. noch die Randeinfassung erreichbar, die Schaukel selbst ist wegen des Sandes – ohne weitere Hilfsmittel – allerdings nicht zu erreichen. Wird hier neben dem Zwei-Wege-Prinzip zusätzlich auch das Zwei-Sinne-Prinzip angewandt, ist die Schaukel nicht nur erreichbar, sondern zusätzlich auch auffindbar. Schön wäre es jetzt noch, wenn das Angebot auch von allen benutzbar ist, also z. B. ein Schaukelsitz, der auch Körperunterstützung bietet.
Wie ist die beste Herangehensweise für die Planung von einem Spielplatz für alle?
Grundlage für jede Spielplatzplanung ist die Beteiligung der Kinder – schließlich geht es ja um ihren Spielplatz. Sind ihre Wünsche und Vorstellungen bekannt, sollte unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden, wo welche Angebote platziert werden – dabei bedeutet Angebot hier nicht nur Spielaktivität, sondern kann auch Rückzugsort oder Platz für Kommunikation und Zusammenkommen meinen. Damit die oben erwähnten Grundbedingungen erfüllt werden, muss als einer der Schlüsselaspekte eine gut nutzbare Wegeführung und damit auch ein funktionierendes Leitsystem eingeplant werden: Wenn Wege nicht nachvollziehbar sind, wird auch die Orientierung nur schlecht funktionieren und die Erreichbarkeit leiden. Nicht zuletzt ist es wichtig, die Kinderwünsche herausfordernd und ansprechend umzusetzen, ohne stigmatisierende Geräte, wie z. B. eine Rollstuhlschaukel. Je mehr Erfahrungsvielfalt und unterschiedliche Bewegungserfahrungen angeboten werden, desto größer ist Spielwert und Qualität der Anlage.
Welche Planungsziele sollte man sich für die Umsetzung und Gestaltung setzen?
Vor allem sollte man nicht versuchen, den inklusiven Spielplatz zu gestalten – es geht nicht um das „Leuchtturmprojekt“, sondern darum, inklusive Gestaltung als Selbstverständlichkeit bei der Planung zu berücksichtigen und diese damit immer weiter zu verbreiten und zu etablieren. Neben einem Angebot für alle soll der Spielplatz vielfältige und sich steigernde Bewegungsanforderungen abbilden. Dies alles in den verschiedenen Bewegungsarten wie laufen, sitzen/stehen, hangeln, klettern, rutschen, springen/hüpfen, krabbeln/ kriechen, rollen/berollen, drehen, balancieren oder schwingen/schaukeln. Ziel muss sein, dass jeder im Rahmen seiner Fähigkeiten ein passendes Angebot erreichen kann. Dabei ist es wichtig, nicht mit bestimmten Geräten separierende Bereiche zu schaffen, sondern eine Begegnung und ein Miteinander aller zu ermöglich.
Zwei-Sinne-Prinzip
Gleichzeitige Vermittlung von Informationen für mindestens zwei Sinne (Sehen, Hören, Fühlen/Tasten). Neben der visuellen Wahrnehmung (Sehen) wird auch die taktile (Fühlen/Tasten, z. B. mit Händen oder Füßen) oder auditive (Hören) Wahrnehmung genutzt.
Zwei-Wege-Prinzip
Erreichung, Erschließung und/oder Benutzung von Einrichtungen und Nutzungsgegenständen auf mindestens zwei unterschiedlich gestalteten Wegen, wovon mindestens einer davon barrierefrei sein muss.
Beispiel: Bei der Überwindung von Höhenunterschieden muss alternativ zum Treppensteigen auch eine Rampe oder ein Aufzug vorhanden sein.
Welche Handlungshilfen bietet hierzu der „Arbeitskreis Inklusion“ des Normungsausschusses NA 112- 07-01 AA Spielplatzgeräte, für den Sie als Obmann aktiv sind?
Bei kaum einem Thema wird so leidenschaftlich diskutiert. Die Gefahr besteht, dass viele Meinungen eingebracht werden, bevor eine gemeinsame Basis geschaffen bzw. eine einheitliche Definition vereinbart wurde. Auch deshalb waren bisher bei der Beauftragung eines inklusiven Spielplatzes die Ergebnisse einer Planung höchst unterschiedlich und weder vergleich- noch überprüfbar. Weit verbreitet war der Gedanke, ein inklusiver Spielplatz muss mit synthetischem Fallschutzbelag ausgestattet und alle Geräte müssen rollstuhltauglich sein. Um hier Spielangebote zu erhalten, die wirklich von allen nutzbar sind, hat der Arbeitskreis Kriterien entwickelt, anhand derer zum einen ein vielfältiges Angebot geschaffen wird, die aber auch die Planung und Umsetzung messbar und nachvollziehbar machen – nämlich, ob das Ziel erreicht wurde. Dabei werden Anforderungen an Zugänglichkeit, Vernetzung – wie Wege und Leitsystem – und Erreichbarkeit der Spielangebote betrachtet und bewertet, zudem, ob ein Spielangebot selbstständig oder (nur) mit Hilfe nutzbar ist. Die Vielfalt der Sinnes- und Bewegungserfahrungen wird überprüft, wie auch die ausreichende Berücksichtigung der in der Inklusions-Matrix definierten sozialen Aspekte.
Welche Normen gilt es zu beachten?
Die Vorgaben für einen inklusiven Spielplatz sind nahezu identisch mit den Vorgaben für die klassische Spielplatzplanung. Wichtigste Planungsgrundlage ist die DIN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen“, in der sich in Teil 1 die allgemeinen Planungsgrundlagen finden. Seit Februar 2024 ist im Teil 2 der DIN 18034 „Matrix mit Bewertungsschema für inklusive Spielräume“ die sog. Inklusions-Matrix verfügbar. Damit wird Planenden und Betreibern ein Bewertungsinstrument zur Verfügung gestellt, das bei der Entstehung und Planung eines Spielplatzes genutzt werden kann und die Bewertung seines inklusiven Charakters erlaubt. Hilfreich sind zudem Kenntnisse der Normenreihe DIN EN 1176 (Sicherheit von Spielplatzgeräten), gerade bezüglich der Anordnung von Spielangeboten unter dem Aspekt der Erreichbarkeit. In der DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ finden sich darüber hinaus wichtige Maße und Vorgaben, die auch auf Spielplätze übertragen werden können. In den Geräten selbst kann allerdings, z. B. bei Steigungsmaßen von Rampen, im Hinblick auf herausfordernde Angebote auch von diesen Vorgaben abgewichen und größere Neigungen zugelassen werden. Eine gute Übersicht und Arbeitshilfe bieten hierzu die Nürnberger Leitlinien für Qualität und Inklusion auf Spielplätzen, Spielhöfen und Aktionsflächen. (Anm. d. Red.: Weitere Informationen unter www.nuernberg.de/internet/jugendamt/ leitlinien_spielflaechen.html)
Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Welche Wünsche haben Sie, wenn es um das Etablieren von Spielflächen für alle geht?
Meine Vision ist, dass zum einen inklusive Spielräume selbstverständlich werden und zugleich auch der Mut zum Ausprobieren bei den Verantwortlichen wächst! Es gibt nicht das eine Rezept für die Planung oder das eine Gerät, welches den Spielplatz inklusiv macht. Wir brauchen vielleicht auch nicht die Leitsysteme aus der gebauten Verkehrswirklichkeit, sondern gleich gut nutzbare Varianten aus gezielt gebauten Wegen nach dem Zwei-Wege- und dem Zwei-Sinne-Prinzip: Spielangebote an den Rand des Weges anzubinden erleichtert beispielsweise die Auffindbarkeit – eine Kleinigkeit in der Planung mit einer allerdings großen Wirkung. Aber auch die verstärkte Umsetzung von einfachen Anpassungen bestehender Spiel-Angebote schwebt mir vor, damit diese von einer breiten Öffentlichkeit genutzt werden können – ohne exkludierende „Spezialangebote“. Ziel sind Spielräume, bei denen Inklusivität selbstverständlich in der Planung und Umsetzung aufgeht und nicht als zusätzlich zu berücksichtigendes Extra behandelt wird.
Das Gespräch führte Julia Ciriacy-Wantrup.